Der Pflanzenbau-Berater Martin Keller sorgt sich um die Qualität der Böden auf den Gemüsebetrieben. In der Erde fehlt es an organischem Material, das die Grundlage für das Leben der wichtigen Mikroorganismen bildet. Im Interview erklärt er, was es für einen gesunden und produktiven Boden braucht.
David Eppenberger: Martin Keller, wie steht es um die Böden im Schweizer Gemüsebau?
Martin Keller*: Je nach Region und Betrieb sehr unterschiedlich. An vielen Orten ist aber die Bodenstruktur ungenügend und die Wasserführung schlecht. Das ist unter anderem eine Folge der Bodenbearbeitung mit den schweren Maschinen. Natürlich spielt auch der Standort eine Rolle. Diesbezüglich ist die Schweiz ein Spezialfall. Viele verschiedene Bodenarten auf engstem Raum gehören nämlich zu den Besonderheiten des Voralpenraumes. Selbst innerhalb des gleichen Betriebes kann sich die Zusammensetzung des Bodens erheblich unterscheiden. Das macht es anspruchsvoll für die Produzenten und die Berater.
Sie sprachen das Problem der Bodenverdichtung an. Sollte ein Profi nicht bereits in seiner Berufsausbildung lernen, dass er mit schweren Maschinen nicht auf nasse Äcker fahren sollte?
Oft stehen wirtschaftliche Zwänge der Vernunft im Weg. Doch das Thema Boden hat an vielen Schulen tatsächlich nicht den Stellenwert, der nötig wäre. Ich habe mich auch erst während meiner Zweitausbildung im Bereich Obst- und Weinbau ernsthaft mit der Geschichte und den Eigenheiten des Bodens auseinandergesetzt. Ich merkte erst da, dass die richtige Pflanzenernährung und Düngung sehr oft mit dem Zustand des Bodens zusammenhängt. Ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig über die Zusammenhänge des Bodens wissenschaftlich geforscht wird, obwohl dieser eigentlich die Grundlage des Ganzen bildet.
Vielleicht ist alles einfach zu komplex?
Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass viele junge – auch gut ausgebildete – Leute eine gewisse Distanz zum Thema Boden bewahren. Vielleicht liegt es daran, dass man viele Einflüsse beachten muss und der Weg über respektive durch den Boden sicher nicht der einfachste ist.
Ist der Substrat-Anbau der einfachere Weg?
Bei dieser Produktionsmethode haben wir in der Tat viele standardisierte Ausgangslagen. Doch bei der Pflanzenernährung weiss man beim Hors-sol-Anbau eigentlich auch noch sehr wenig. Den Pflanzenbedarf kennt man heute zwar während der Vegetationsperiode. Aber innerhalb von diesen gibt es wiederum verschiedene Entwicklungsstadien bei den Pflanzen. Was diese dort spezifisch benötigen, kann mir eigentlich bei den wenigsten Kulturen jemand sagen.
Gehen wir also wieder zurück auf den natürlichen Boden. Wie es aussieht, wird die Anzahl der zugelassenen Wirkstoffe in Zukunft abnehmen. Was bedeutet das für die landwirtschaftlichen Böden in der Schweiz?
Mit dem Rückgang der heute zur Verfügung stehenden Pflanzenwirkstoffe werden die Probleme im Boden noch zunehmen. Der Einsatz von breitwirkenden Insektiziden wird sich erhöhen. Wenn immer wieder der gleiche Wirkstoff verwendet wird, nehmen die Resistenzen zu. Es muss also immer mehr eingesetzt werden um überhaupt noch einen Effekt zu bewirken. Der Eingriff in die Bodenfauna ist dann massiv. Die wichtigen Mikroorganismen und damit auch die Grundvoraussetzung für eine gute Bodenstruktur werden zerstört. Dazu kommt eine höhere Fliesswasserbelastung der einzelnen Wirkstoffe.
Ist diese behördlich verfügte Reduktion von Pflanzenschutzmitteln also kontraproduktiv?
Ja. Sie ist auch eine Reaktion darauf, dass bestimmte Verteilketten – leider auch unsere beiden grossen in der Schweiz –, sich profilieren wollen und sich gegenseitig hochschaukeln, nur um sagen zu können «Wir haben noch weniger Pflanzenschutzmittel zugelassen.» Doch das dient der Sache überhaupt nicht. In Deutschland ist man bei der Produktion an manchen Orten bereits am Punkt angelangt, wo der Anbau gar nicht mehr machbar ist. In der Schweiz hatten wir bisher eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Weil wir eine breite Palette von Wirkstoffen zur Verfügung hatten, wirkten wir auch weniger spezifisch auf gewisse Bakterienstämme ein. Doch mit den neuen Regelungen dürfte sich eine gewisse Palette von Stämmen verabschieden. Man kann hier nur sagen: «Denn sie wussten nicht, was sie tun.»
Gemüsebetriebe sind heute stark spezialisiert und werden entsprechend intensiv bewirtschaftet. Was bedeutet das für die Böden?
Früher hatte in der Fruchtfolge die Graswirtschaft einen festen Platz. Ideal wären auch heute zwischendurch zwei- bis dreijährige Kunstwiesen. Obwohl durch diese auch wieder Probleme entstehen können – beispielsweise mit Drahtwürmern – wäre das für die Bodentätigkeit ideal. Doch die spezialisierten Gemüsebaubetriebe befinden sich heute in wirtschaftlichen Zwängen, die Grünland in der Fruchtfolge kaum mehr zulassen. Für die Beruhigung des Bodens wäre das aber wichtig.
Sie würden also eigentlich den Betriebsleitern gerne eine Kunstwiese in der Fruchtfolge empfehlen. Sie wissen aber von vornherein, dass diese unrealistisch ist?
Sie ist effektiv unrealistisch. Eine Möglichkeit wären allenfalls überbetriebliche Fruchtfolgen. Einzelne Gemüsebaubetriebe machen dies bereits, um wieder eine sinnvolle Fruchtfolge hereinzubringen. Doch überbetriebliche Landabtausche funktionieren nicht automatisch. Oft scheitert es am Abtauschpartner. Denn es spielt natürlich eine Rolle, wie man mit dem Land des Kollegen umgeht.
Ist es für Sie nicht frustrierend, auf einen Betrieb zu kommen und zu wissen, dass man eigentlich nur Symptome bekämpfen kann und nicht die Ursache?
Es gibt neben der Fruchtfolge schon noch Möglichkeiten, positiv auf den Boden einzuwirken. Ein Problem ist beispielsweise, dass man organisches Material nicht mehr in den Boden einarbeitet und Ernterückstände zu lange herumliegen lässt anstatt diese mit geringen Bodenbearbeitungsmassnahmen einzuarbeiten. Das wäre auch für die Vermeidung von Pflanzenkrankheiten sinnvoll. Aber auf vielen Betrieben fehlen heute während der Saison schlicht die Zeit und das Personal für solche Massnahmen. Mit der Feldhygiene könnte man aber sicher noch viel erreichen. Diese würde sich auch positiv auf den Unkrautdruck auswirken. Dieser ist auf einigen Betrieben bereits sehr gross, weil das Unkraut mangels Bekämpfung immer wieder absamen kann.
Ein Teufelskreis. Man verpasst den Zeitpunkt und das Unkraut kommt immer wieder und immer mehr. Man benötigt so immer mehr Zeit um das Problem zu lösen. Zeit die niemand hat?
Inzwischen ist es sogar schon soweit, dass man an gewissen Orten das Unkraut-Problem fast nicht mehr beheben kann. Effektiv ein Teufelskreis. Es braucht dann entsprechend immer mehr Aufwand, das heisst Zeit und chemische Hilfsstoffe. Alternativen wären mechanische Bearbeitungen wie Hacken oder Bürsten, doch auch das braucht Zeit und kostet. Und ganz ohne Chemie geht es in solchen Fällen nicht mehr. Mehr Disziplin bei der Unkrautbekämpfung würde sich bezahlt machen.
Welche Probleme bestehen sonst noch bei der Bodenbearbeitung?
Oft erfolgt die Saatbettbereitung zu fein. Grund dafür sind Bequemlichkeit und mangelndes Wissen. Teilweise hat es mit alter Mechanisierung zu tun. Die heutigen Sämaschinen setzen aber nicht mehr ein so feines Saatbett voraus, wie das früher noch der Fall war. Durch die feine Erde verschlämmt der Boden. Die Bodenstruktur wird so langfristig zerstört. Und die Erosion nimmt zu.
Wie schlimm ist die Erosion auf den Schweizer Äckern?
Sie ist teilweise problematisch oder sogar tragisch. Je länger die Böden offen sind, desto mehr wird die Erosion zunehmen. Und je grösser die Flächen werden umso schlimmer. Die Böden verschliessen sich oder werden bei grossen Niederschlägen komplett weggeschwemmt. Erosionsschäden werden bei dieser Spezialisierung weiter zunehmen. Sie führen in schlimmen Fällen zu Kultur-Ausfällen von bis zu 90 Prozent.
Aber Ackerbau gab es doch früher auch schon?
Ja. Aber die Flächen waren kleiner und vielfältiger mit viel mehr Fruchtfolgen. Dadurch kam viel organisches Material in die Böden. Das führte zu einer ganz anderen Bodenstruktur.
Klären Bodenanalysen über den Zustand des Bodens auf?
Bodenproben legen offen, wie viele Nährstoffe im Boden sind. Sie zeigen den pH-Wert und die Nährstoffverhältnisse auf. Das Verhältnis zwischen Hauptnährstoffen und Mikronährstoffen sollte grundsätzlich nicht mehr wie 1:3 sein. Bodenproben sagen aber nichts aus über die Bodenstruktur und wenig über die Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe. Sie lassen allenfalls eine Grobbeurteilung zu. Sofort sieht man aber, wenn ein Boden versalzen ist, als Folge des hohen Einsatzes von Mineraldünger. Gerade im Gemüsebau ist die Versalzung ein grosses Thema. In solchen Fällen muss man die Bodentätigkeit wieder anregen, damit das Salz wieder aufgeschlossen und in die ursprüngliche Form zurückgebracht werden kann.
Wie regt man solche Böden an?
Kurzfristig durch eine mechanische Bodenbearbeitung, die wieder Luft in den Boden reinbringt. Doch ohne weitere Massnahmen fällt er immer wieder in die ursprüngliche Struktur zurück. Mit der Einarbeitung von organischem Material kann das Problem gelöst werden. In Form von Kompost beispielsweise. Beim Kompost sollte man aber unbedingt darauf achten, dass er eingearbeitet wird. oberflächlich ausgebracht würde der Unkrautdruck zu gross. Kuhmist, Substrate von Biogasanlagen oder getrockneter Hühnermist sind andere gute organische Dünger.
Welcher organische Dünger ist am besten?
Ideal wäre eine Abwechslung. Hühnermist und Kompost sind phosphorlastig. Kuhgülle ist eher Kali betont. Positiv bei organischen Düngern ist, dass sie Mikronährstoffe wie Bor enthalten. Ich kenne viele Betriebe, die seit vielen Jahren nur noch mit Mineraldüngern arbeiten und deshalb unter einem Bor-Mangel leiden.
Was halten Sie vom Einsatz von effektiven Mikroorganismen (EM)?
Mikroorganismen sind für den Boden eine gute Sache. Allzu oft wird aber nur von den «EM» gesprochen. Dieses Produkt kommt ursprünglich aus Asien und besteht aus Stämmen, deren genetischen Eigenschaften – wie Temperaturverlauf, Lichtintensität etc. – auf die asiatische Umgebung eingestellt sind. Unter unseren ganz anderen Bedingungen in der Schweiz sind sie aber deutlich zu wenig effizient. Im Prinzip müsste man die Stämme bei uns lokalisieren und das Produkt neu kreieren. Ein Problem ist auch die Selbstvermehrung, die sehr anspruchsvoll ist. Wenn man diese Endprodukte genau untersucht, dann sind manchmal nur noch 30 von den eigentlich nötigen 80 Stämmen vorhanden. Das Produkt verliert dann endgültig seine Wirkung.
Können Mikroorganismen heruntergewirtschaftete Böden retten?
Alleine nicht. Sie brauchen den richtigen Boden. Man muss diesen aufreissen und mindestens im Abstand von 10 bis 14 Tagen eine Gabe mit Mikroorganismen applizieren. Diese müssen dann mit organischem Material langfristig bei Laune gehalten werden. Das ist ein Prozess. Man kann nicht innerhalb von einer Woche gutmachen, was zuvor in 20 Jahren zerstört wurde. Mikroorganismen müssen professionell und zur richtigen Zeit angewendet werden. Das ist schwieriger als man denkt. Ich sehe immer wieder auch bei Pflanzenschutzpräparaten, dass rund 20 bis 30 Prozent im falschen Zeitpunkt appliziert werden. Dann gilt: Ausser Spesen nichts gewesen.
Wie sieht es mit dem Einsatz von Kalk aus?
Junger Meeralgenkalk mit seinen doppelt geladenen Kalzium-Ionen hat eine äusserst positive Wirkung auf die Bodenstruktur. Bei Kalk gilt: Je jünger desto besser. Gut ist deshalb auch Kreidekalk. Oft arbeite ich erfolgreich mit ganz feinem Meeralgenkalk. Aus Kostengründen nehmen aber viele den günstigeren aber mit schlechteren Eigenschaften ausgestatteten Gesteinskalk. Bei Meeralgenkalk reicht in pH-hohen Bereichen eine geringe Gabe von 300 kg pro Hektare um eine deutliche Verbesserung der Bodenstruktur zu erreichen. Die Oberflächenstruktur des Meeralgenkalkes ist viel poröser als bei Gesteinskalk. Ein Gramm in der Grössenordnung von 38 Micron hat eine spezifische Oberfläche von 20 Quadratmeter. Und das wirkt sich positiv aus.
Was ist entscheidend für eine gute Bodenstruktur?
Abwechslung und Bodenleben sind entscheidend. Unsere Vorfahren sind mit der Fünf-Felder-Bewirtschaftung eigentlich ganz gut gefahren.
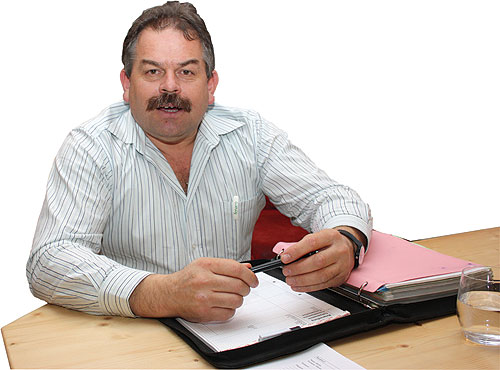

Kommentare